Häufig gestellte Fragen
Umfassende Informationen sowie häufig gestellte Fragen zu Briefwahlen für die Kommunalwahlen am 14. September 2025 finden Sie hier.
Ein/e Wahlberechtigte/r, die/der in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann ihr/sein Wahlrecht auch durch Briefwahl ausüben.
Für die Briefwahl ist ein entsprechender Antrag zu stellen. Der Antrag auf Aushändigung der Briefwahlunterlagen sollte möglichst frühzeitig bei der für die/den Wahlberechtigten zuständigen Gemeindebehörde gestellt werden. Der Antrag kann schriftlich oder mündlich gestellt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.
Eine behinderte Wahlberechtigte bzw. ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen kann frühestens nach der endgültigen Zulassung der Wahlvorschläge und dem Druck der Stimmzettel erfolgen. Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag vor dem Wahltag, 15.00 Uhr und in besonderen Fällen auch noch am Wahltag bis 15.00 Uhr beantragt werden.
Von großer Wichtigkeit ist es, dass die/der Briefwähler den Wahlbriefumschlag rechtzeitig abschickt oder bei der für den Eingang der Wahlbriefe zuständigen Stelle abgibt. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag bis 16.00 Uhr bei der dafür zuständigen Stelle vorliegen. Der Wahlbrief sollte daher bereits einige Tage vor dem Wahltag abgeschickt werden. Die Briefwahl kann aber auch sofort nach Erhalt der Briefwahlunterlagen erfolgen und der Wahlbrief sofort danach an die auf dem Umschlag abgedruckte Anschrift geschickt oder dort abgegeben werden. Holt die/der Wahlberechtigte persönlich die Briefwahlunterlagen ab, so soll ihr/ihm die Gemeindebehörde Gelegenheit geben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.
Zu beachten ist, dass vor einem Fortzug aus einer Gemeinde und ggf. aus einem Kreis abgegebene Briefwahlstimmen ungültig werden, bei einem Wohnortwechsel innerhalb desselben Kreises auch für die Kreiswahl (§ 27 Abs. 4 Satz 2 KWahlG). Die betreffenden Wahlberechtigten dürfen aber am neuen Wohnort zur Gemeindewahl wählen (auch per erneuter Briefwahl), wenn sie sich bei der dortigen Meldebehörde bis zum 16. Tag vor der Wahl angemeldet haben (§§ 7, 10 Abs. 1 Satz 3 KWahlG). Bei einem Wohnortwechsel innerhalb desselben Kreises können sie in der neuen Gemeinde auch zur Kreiswahl wählen (ebenfalls auch per erneuter Briefwahl). Nicht mehr möglich ist die Wahl am bisherigen Wohnort, da sie dort nicht mehr ihre Wohnung haben. Eine Doppelwahl am alten und neuen Wohnort ist unzulässig.
Darf eine amtierende Bürgermeisterin bzw. ein Bürgermeister oder eine amtierende Landrätin bzw. ein Landrat Wahlleiter/in sein, wenn sie oder er selbst wieder für dieses Amt kandidiert? Dürfen andere Bewerberinnen und Bewerber um dieses Amt Mitglied im Wahlausschuss sein? Dürfen Wahlbewerber/innen Mitglied eines Wahlvorstands sein?
Der Wahlausschuss besteht aus der Wahlleiterin als Vorsitzender bzw. dem Wahlleiter als Vorsitzendem und vier, sechs, acht oder zehn Beisitzerinnen und Beisitzern, die die Vertretung des Wahlgebiets wählt (§ 2 Abs. 3 KWahlG). Wahlleiter/in ist die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte des Wahlgebiets, stellvertretende/r Wahlleiter/in ist ihr/e Vertreter/in bzw. sein/e Vertreter/in im Amt. Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 KWahlG können Bewerber/innen für das Amt der/des hauptamtlichen Bürgermeisterin/Bürgermeisters oder der/des hauptamtlichen Landrätin/Landrates ab Bekanntgabe ihrer Kandidatur nicht zugleich Wahlleiter/in oder stellvertretende/r Wahlleiter/in sein; an ihre Stelle treten die jeweiligen Vertreter/innen im Amt. Im Verzichtsfall (§ 2 Abs. 2 Satz 4 KWahlG) ist Wahlleiter bzw. Wahlleiterin ebenfalls der bzw. die jeweilige Vertreter/in im Amt. Besonderheiten gelten, wenn eine Bürgermeisterin / ein Bürgermeister als Landrätin / Landrat desselben Kreises kandidiert oder sich eine Landrätin / ein Landrat für ein Bürgermeisteramt in ihrem/seinem Kreis bewirbt.
Bewerberinnen und Bewerber für das Amt der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters oder der Landrätin / des Landrats können nicht Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde oder des Kreises sein (§ 2 Abs. 7 Satz 2 KWahlG). Ergibt sich nach der Bildung des Wahlausschusses, dass ein Mitglied für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters oder der Landrätin/des Landrats kandidiert, ist durch die Vertretung ein/e Nachfolger/in zu wählen.
In einem Wahlvorstand können Bewerberinnen / Bewerber für das Amt der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters oder der Landrätin / des Landrats nicht Mitglied sein (§ 2 Abs. 7 Satz 2 KWahlG). Andere Wahlbewerberinnen und -bewerber dürfen nicht Mitglied eines Wahlvorstands in dem Wahlbezirk sein, in dem sie aufgestellt sind (Wahlbezirksbewerber/innen) oder ihre Wohnung haben (auf Reservelisten aufgestellte Bewerber/innen), (§ 2 Abs. 7 Satz 3 KWahlG).
Parteien oder Wählergruppen, die in der laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag vertreten sind, müssen, um einen Wahlvorschlag einreichen zu können, nachweisen, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm haben und dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm in geeigneter Weise veröffentlich sind. Die Wahlvorschläge dieser Parteien und Wählergruppen müssen außerdem durch eine gesetzlich bestimmte Anzahl von Wahlberechtigten unterzeichnet sein, d.h. es müssen sog. Unterstützungsunterschriften beigebracht werden (§ 15 Abs. 2 Satz 3, § 16 Abs. 1, § 46a Abs. 5, § 46d Abs. 1 Satz 3 KWahlG).
Verbindungen von Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung eines gemeinsamen Kandidaten für die Wahl der Vertretungen sind nicht zulässig:
Schließen sich Parteien und/oder Wählergruppen zu neuen Gruppierungen zwecks Aufstellung gemeinsamer Kandidatinnen und Kandidaten zusammen, ist zu beachten, dass es sich, wenn keine Identität mit der bisherigen Gruppe gegeben ist, um neue Gruppen handelt, die die Privilegierung sog. alter Parteien und Wählergruppen nicht in Anspruch nehmen können. Solche Gruppen werden also in der Regel Unterstützungsunterschriften erbringen sowie einen demokratisch gewählten Vorstand, Satzung und Programm nachweisen müssen. Sie werden in ihren Bezeichnungen der Verwechslungsgefahr mit alten Parteien und Wählergruppen Rechnung tragen müssen und können für die Reihenfolge auf dem Stimmzettel keine Stimmen der vorangegangenen Wahl im Wahlgebiet in Anspruch nehmen.
Demgegenüber ist aber nicht ausgeschlossen, dass eine Gruppierung auf einen eigenen förmlichen Wahlvorschlag verzichtet und stattdessen öffentlich für den Wahlvorschlag einer anderen Partei oder Wählergruppe eintritt.
Die Gründung einer kommunalen Wählergemeinschaft ist frei. Gesetzliche Vorgaben bestehen nicht. Es ist ausreichend, dass interessierte Personen zu einer Gründungsversammlung eingeladen werden. Auf dieser Versammlung muss ein vom gemeinsamen Willen getragener Gründungsvertrag zur Bildung einer kommunalen Wählergemeinschaft geschlossen werden. Der Gründungsvertrag sollte dokumentiert werden.
Obwohl es für kommunale Wählergemeinschaften - anders als für politische Parteien - keine gesetzlichen Vorgaben gibt, ist es gleichwohl zweckmäßig, in einer solchen Gründungsversammlung (oder zu einem späteren Zeitpunkt) auch eine Satzung und ein Programm zu beschließen. Die Satzung sollte u.a. Regelungen über den Namen der Wählergemeinschaft, die Bildung und Zuständigkeiten der einzelnen Organe (z.B. Vorstand, Mitgliederversammlung usw.) und die Voraussetzungen der Mitgliedschaft enthalten. Das Programm enthält üblicherweise die politischen Kernaussagen, denen sich eine politische Vereinigung verpflichtet fühlt.
Nur solche Wählergemeinschaften, die Gruppen „von mitgliedschaftlich organisierten Wahlberechtigten" (§ 15 Abs. 1 Satz 2 KWahlG) sind, können Wahlvorschläge einreichen. Wählergemeinschaften, die sich aus anderen Wählergruppen zusammensetzen (z. B. eine Wählergemeinschaft auf Kreisebene, in der sich Wählergruppen aus kreisangehörigen Gemeinden zusammengeschlossen haben), dürfen sich als solche nicht an der Wahl beteiligen.
Eine kommunale Wählergemeinschaft (das Kommunalwahlgesetz spricht von Wählergruppen, im § 15 Abs. 1 KWahlG als „Gruppen von mitgliedschaftlich organisierten Wahlberechtigten" definiert), die sich an einer Kommunalwahl beteiligen möchte, hat die Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) und der Kommunalwahlordnung (KWahlO) zu beachten. Beide Rechtstexte können im Internetangebot des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen unter “Wahlen", „Rechtsgrundlagen" eingesehen werden.
Das Verfahren für die Aufstellung der Wahlbewerber/innen regeln die Rahmenvorgaben des Kommunalwahlrechts.
Danach muss die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten in einer Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder der Wählergruppe im Wahlgebiet (Mitgliederversammlung) oder in einer Versammlung der von den wahlberechtigten Mitgliedern der Wählergruppe im Wahlgebiet aus ihrer Mitte gewählten Vertreter/innen (Vertreter- bzw. Delegiertenversammlung) erfolgen.
Die Wahl der Vertreter/innen und der Kandidatinnen / Kandidaten ist geheim und muss demokratischen Grundsätzen genügen. Die Erfüllung dieser Anforderungen ist von der Leiterin / dem Leiter der Versammlung sowie von zwei von der Versammlung bestimmten Teilnehmerinnen / Teilnehmern gegenüber der Wahlleiterin / dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern. Den Bewerberinnen / Bewerbern und Ersatzbewerberinnen / -bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.
Über die Mitgliederversammlung bzw. Vertreterversammlung zur Aufstellung der Kandidatinnen / Kandidaten ist eine Niederschrift zu fertigen, die zusammen mit dem Wahlvorschlag, der Versicherung an Eides statt, den Zustimmungserklärungen der Kandidatinnen / Kandidaten und den Bescheinigungen der Wählbarkeit der Kandidatinnen / Kandidaten bei der Wahlleiterin / dem Wahlleiter einzureichen sind. Für den Wahlvorschlag, die Niederschrift, die Versicherung an Eides statt sowie die Zustimmungserklärungen und Wählbarkeitsbescheinigungen sind die nach der Kommunalwahlordnung vorgesehenen Vordrucke zu verwenden. Diese können von den Parteien, Wählergruppen und sonstigen Wahlbewerberinnen / Wahlbewerbern kostenlos bei dem / der örtlichen Wahlleiter/in angefordert werden.
Wählergruppen müssen ihrem Wahlvorschlag zudem die in § 15a KWahlG vorgesehenen Nachweise bzw. Erklärungen beifügen.
Der Wahlvorschlag muss von der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags zuständigen Leitung der Wählergruppe unterzeichnet werden. Wählergruppen, die in der im Zeitpunkt der Festsetzung des Wahltermins laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten sind, müssen zudem nachweisen, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm haben und dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm in geeigneter Weise veröffentlich sind. In diesem Fall sind also eine Satzung und ein Programm nicht nur zweckmäßig, sondern erforderlich. Darüber hinaus müssen solche Wählergruppen ihrem Wahlvorschlag sogenannte Unterstützungsunterschriften hinzufügen, die ebenfalls auf amtlichen Vordrucken erbracht werden müssen. Die Vordrucke werden von der Wahlleiterin / dem Wahlleiter auf Anforderung kostenlos geliefert.
Die Anzahl der beizubringenden Unterstützungsunterschriften für eine Bewerberin / einen Bewerber in einem Wahlbezirk, für eine Reserveliste oder für eine Bewerberin / einen Bewerber für das Amt der (Ober-)Bürgermeisterin / des (Ober-)Bürgermeisters oder der Landrätin / des Landrats ist jeweils verschieden. Sie ist darüber hinaus von der Anzahl der Wahlberechtigten in einem Wahlbezirk bzw. im Wahlgebiet abhängig. Eine konkrete Auskunft kann deshalb nur die zuständige Kommune geben.
Wahlvorschläge können bis zum 69. Tag vor der Wahl 18.00 Uhr bei der örtlichen Wahlleiterin / dem örtlichen Wahlleiter eingereicht werden. Gleichwohl ist es ratsam, Wahlvorschläge vor diesem Endtermin einzureichen, damit die Wahlleiterin / der Wahlleiter hinreichend Zeit und Gelegenheit hat, den Wahlvorschlag zu prüfen und auf eventuelle Mängel aufmerksam zu machen, denen ggf. noch abgeholfen werden kann.
Die vorstehenden Ausführungen wollen und können nur einen ersten, groben Überblick über die Voraussetzungen einer Beteiligung einer Wählergruppe an der Kommunalwahl geben. Sie sind keineswegs vollständig. Wählergruppen, die sich an der Kommunalwahl beteiligen möchten, wird deshalb dringend empfohlen, sich mit den rechtlichen Grundlagen (Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung) vertraut zu machen und insbesondere die Beratung der örtlichen Wahlleiterin / des örtlichen Wahlleiters bzw. des Wahlamtes der Gemeinde oder des Kreises zu suchen. Dort können auch sämtliche für die Beteiligung an der Kommunalwahl notwendigen Vordrucke bezogen werden.
Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung vom 10. Juni 2025, welches am 27. Juni 2025 verkündet wurde, gilt für die Kommunalwahlen 2025 das auch bei den letzten Kommunalwahlen angewandte Sitzzuteilungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers.
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hatte am 4. Juli 2024 zwar einen Wechsel dieses Verfahrens zu einem Quotenverfahren mit prozentualem Restausgleich (sog. Rock-Verfahren) beschlossen. Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster hat in mehreren gleichlautenden Urteilen am 20. Mai 2025 jedoch entschieden, dass diese jüngste Änderung des bei den Kommunalwahlen anzuwendenden Sitzverteilungsverfahrens, die in § 33 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) normiert ist, die verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte auf Chancengleichheit als politische Parteien und auf Gleichheit der Wahl der Landesverbände verschiedener politischer Parteien verletzt. Das sog. Rock-Verfahren wird bei den kommenden Kommunalwahlen am 14. September 2025 daher nicht angewendet. Durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs kommt es jedoch nicht automatisch wieder zur Anwendung des alten Verfahrens. Der Landtag hat deshalb die Rückkehr zum bisher verwendeten Verfahren beschlossen.
Pressemitteilung des Verfassungsgerichtshofs: https://www.verfgh.nrw.de/aktuelles/pressemitteilungen/2025/11_250520/index.php
Nein.
Nach § 15a Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) mussten Wählergruppen, die nach § 2 Abs. 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes einer Pflicht zur Rechenschaftslegung unterliegen, ihrem Wahlvorschlag eine Bescheinigung beifügen, die ihnen der Präsident des Landtages über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Mit Beschluss vom 6. Mai 2025 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster einer hiergegen gerichteten Verfassungsbeschwerde teilweise stattgegeben, da er in der Regelung des § 15a Abs. 1 KWahlG eine verfassungswidrige Benachteiligung gesehen hat. Die vom Verfassungsgerichtshof erklärte Nichtigkeit des Absatzes 1 hat der Landesgesetzgeber ebenfalls durch eine entsprechende Streichung des § 15a Abs. 1 KWahlG umgesetzt. Die weiteren Regelungen des § 15a KWahlG bleiben hingegen weiterhin anwendbar.
Pressemitteilung des Verfassungsgerichtshofs: https://www.verfgh.nrw.de/aktuelles/pressemitteilungen/2025/10_250508/index.php
Die Wahl der Farben der Stimmzettel ist nicht gesetzlich vorgegeben, die Kommunen entscheiden das also selbst. Die Stimmzettel müssen aber in jedem Wahlbezirk von gleicher Farbe und Beschaffenheit sein und sich hinsichtlich der einzelnen Wahlen farblich deutlich voneinander unterscheiden.
Die Kommunalwahlen am 14. September 2025 sind eigenständige Wahlen der einzelnen Kommunen. Die Landeswahlleiterin erhält über die Schnellmeldungen der jeweilige Kommune die Ergebnisse der Vertretungswahlen in kreisfreien Städten und Kreisen, die zeitnah auf der Internetseite veröffentlicht werden. Hieraus wird ein sog. „Landesergebnis“ errechnet. In der Regel ist es - je nach Meldung durch die Kommunen - in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages verfügbar. Ebenfalls auf dieser Seite sind die Ergebnisse der Personenwahlen für die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und Landrätinnen und Landräte abrufbar. Es wird dort zudem eine Sammlung von Verlinkungen geben, über die man auf die Internetseiten der einzelnen Gemeinden gelangen und die jeweiligen Wahlergebnisse einsehen kann.
Die Wählerinnen und Wähler können bis zu vier (kreisfreie Städte) oder fünf (kreisangehörige Gemeinden) verschiedene Stimmzettel erhalten.
Dies sind im Einzelnen:
- bei kreisfreien Städten:
- Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
- Ratswahl
- Bezirksvertretungswahl
- ggf. Wahl zur Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr
- bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden:
- Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters
- Ratswahl
- Wahl des Landrats / der Landrätin
- Kreistagswahl
- ggf. Wahl zur Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr
Die abgeschnittene rechte obere Ecke dient der Erkennbarkeit des Stimmzettels für blinde und sehbehinderte Personen. Auf diese Weise können sie erkennen, wo oben und vorne beim Stimmzettel ist und diesen in die entsprechende Wahlhilfeschablone korrekt einlegen.
Ebenso wie die abgeschnittene rechte obere Ecke dienen auch die am unteren Rand angebrachten Lochungen der Erkennbarkeit für blinde und sehbehinderte Personen. Auf diese Weise kann erkannt werden, für welche Wahl der Stimmzettel gilt.
Folgende Lochungen sind bei den Kommunalwahlen 2025 vorgesehen:
Kein Loch Ratswahl
1 Loch (Ober-)Bürgermeisterwahl
2 Löcher Wahl der Bezirksvertretung
3 Löcher Kreistagswahl
4 Löcher Landratswahl
5 Löcher Wahl zur Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr
Die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen 2020 sind hier abrufbar.
Für die Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte gilt bei den Kommunalwahlen in NRW - nach einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichtshofes - keine Sperrklausel. Nur für die Wahlen zur Regionalversammlung Ruhr und zu den Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten gilt eine Hürde von 2,5 Prozent. Dort nehmen nur Parteien oder Wählervereinigungen, die mehr als 2,5 Prozent der Stimmen erhalten haben, an der Sitzverteilung für das entsprechende Gremium teil.
Die Stichwahl ist eine Besonderheit der Kommunalwahl. Erhält von mehreren Bewerbern oder Bewerberinnen keiner bzw. keine mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl - also am 28. September 2025 - eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Es wird auf Grund desselben Wählerverzeichnisses gewählt wie bei der ersten Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los darüber, wer an der Stichwahl teilnimmt. Bei der Stichwahl ist die Bewerberin bzw. der Bewerber gewählt, die oder der von den gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.
Mit diesem Oberbegriff sind die (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober) Bürgermeister sowie die Landrätinnen und Landräte gemeint.
Am 14. September 2025 wird in Wesseling, Rees, Lotte, Sonsbeck, Niederkassel, Neunkirchen, Verl, Wegberg und Gütersloh keine Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters stattfinden. Zudem wird es in den Kreisen Kleve und Minden-Lübbecke keine Wahl einer Landrätin oder eines Landrates geben.
In diesen Kommunen kam es mehr als zwei Jahre nach dem letzten regulären Kommunalwahltermin im Jahr 2020 zu einer Neuwahl der Hauptverwaltungsbeamten. In der Folge verlängert sich die Wahlperiode dort bis zu den nächsten allgemeinen Kommunalwahlen, die voraussichtlich im Jahr 2030 stattfinden werden. Rechtsgrundlage hierfür ist § 65 Abs. 5 der Gemeindeordnung NRW sowie § 44 Abs. 5 der Kreisordnung NRW.
Die Abstimmung bei nur einer Kandidatin oder einem Kandidaten erfolgt mittels Ankreuzen der Möglichkeiten „Ja“ oder „Nein“. Gibt es nur einen zugelassenen Wahlvorschlag, ist die Bewerberin / der Bewerber gewählt, wenn sich die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler für ihn entschieden hat. Wird die notwendige Mehrheit nicht erreicht, ist eine Neuwahl durchzuführen.
Mit Wahlwerbung präsentieren Parteien sich und ihr politisches Programm, um damit Stimmen zu sammeln.
Die Wahlwerbung ist gesetzlich nicht geregelt. Die grundsätzliche Möglichkeit der Wahlwerbung wird geschützt durch Art. 5 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) (Pressefreiheit), Art. 5 Abs. 3 GG (Kunstfreiheit) und Art. 21 GG (Parteienprivileg).
Die Landeswahlleiterin ist für die Wahlwerbung und deren rechtliche Beurteilung nicht zuständig und zur Neutralität verpflichtet.
Die Parteien sind für die Inhalte ihrer Wahlwerbung selbst verantwortlich.
Wahlwerbung hat ihre Grenzen, wo verbotene Parteien Wahlwerbung betreiben oder wo die Wahlwerbung strafbar ist. Sie unterliegt den allgemein geltenden Gesetzen.
Für die Genehmigung zur:
- Plakatwerbung
- Benutzung von Lautsprechern und Megaphonen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
- Aufstellung von Infoständen auf öffentlichen Straßen und Plätzen
- Benutzung öffentlicher Einrichtungen
sind die Gemeinden zuständig. Die rechtlichen Rahmenbedingungen finden sich z.B. in den Satzungen der Gemeinden, dem Erlass zur Wahlwerbung außerhalb von geschlossenen Ortschaften und dem Landespressegesetz.
Während der Wahlzeit ist gemäß § 24 Abs. 3 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in und an allen Gebäuden, in denen sich Wahlräume befinden, sowie unmittelbar vor den Zugängen zu den Gebäuden jede Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler verboten. Eine Beeinflussung kann durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder Unterschriftensammlung erfolgen.
Der Grundsatz der freien Wahl umfasst auch die Freiheit, an einzelnen Wahlen nicht teilzunehmen. Da die Kommunalwahlen aus mehreren verbundenen Einzelwahlen bestehen, steht es den Wählenden frei, nicht alle Stimmzettel auszufüllen. Dies gilt auch für die Briefwahl. Die abgegebenen Stimmen behalten Ihre Gültigkeit.
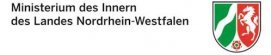
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: